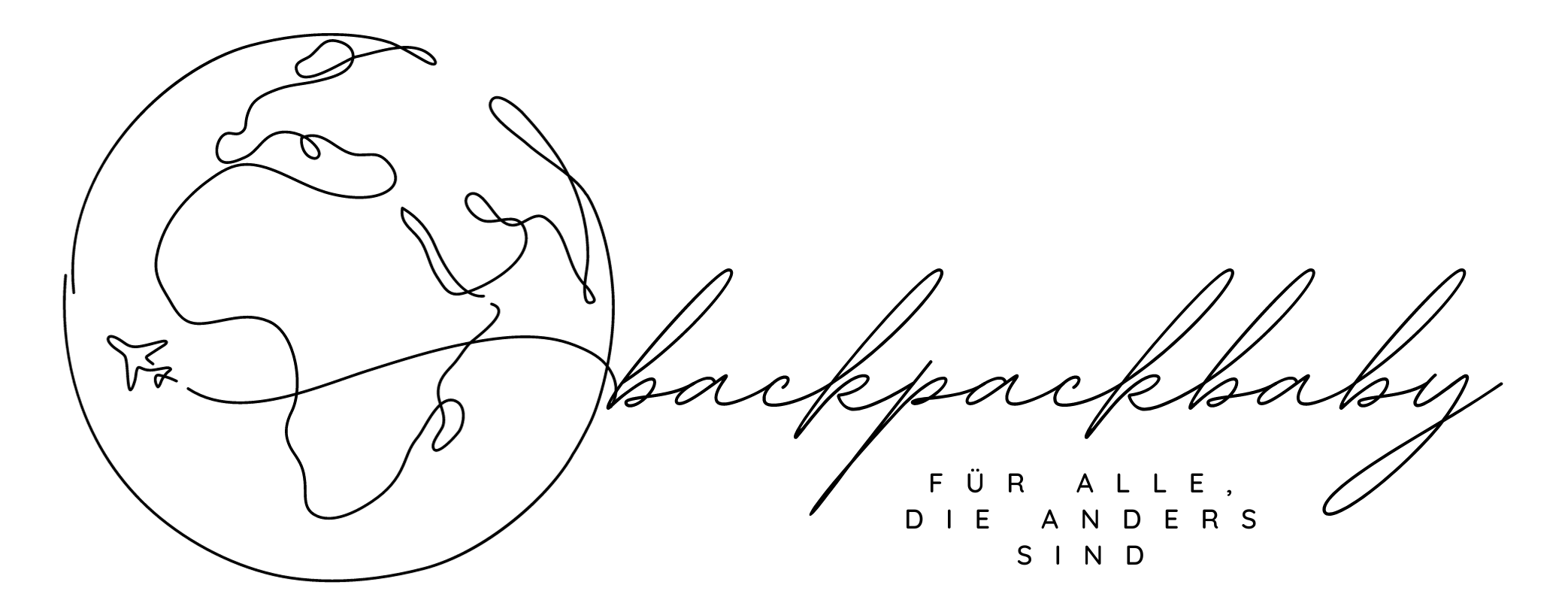Wenn ich die Worte „klassische Architektur“ höre und mir dazu ein Bergarbeiterstädtchen vorstelle, in dem Gold und Kupfer gefördert wurden, dann lande ich irgendwo in der amerikanischen Prärie mit schiefen Holzhütten, allein auf weiter Flur. Ich lande ganz sicher nicht mitten im subtropischen Dschungel in einem am Hang klebenden Bazar, in dem früher mal fliegende, mittlerweile gelandete Händler vom Quallenpudding über den Peniskuchen (aus Teig, keine Sorge!) bis hin zu Badezubern alles anbieten, was sich über Serpentinen nach oben transportieren lässt. Die Architektur, in der das Ganze stattfindet, wirkt bestenfalls altbacken, aber nicht antik. Selbst die Grabanlagen, die einen nahen Hügel überziehen, wirken irgendwie eleganter, als hätten die Verstorbenen einfach beschlossen, wenigstens im Jenseits stilvoll zu wohnen.
So lässt sich eine der bekannteren Sehenswürdigkeiten Taiwans beschreiben: Jiufen. Wer um alles in der Welt würde hier hochfahren, nur um einen Badezuber zu kaufen – und ihn dann ernsthaft mit sich herunterschleppen?
Josi weist mich zu Recht darauf hin, dass hier die Besiedelung viel später begonnen hat als in vielen Regionen Europas – hier kann es gar nicht so viel Altes geben, und wenn, dann wurde es schon hundertfach transformiert. Kein Wunder stürzen sich alle auf jedes Gebäude, dass älter ist als 100 Jahre. Deutschland sieht in meiner Erinnerung wesentlich älter aus. Dafür ist die Aussicht über die Buchten vor Keelung einfach unvergleichlich schön. Derartig steile Klippen, die sich wie Finger ins Meer krallen, haben wir zu Hause einfach nicht.
Außerhalb der gewohnten Umgebung zu sein, ruft einem nicht nur die Unterschiede oder Besonderheiten seines Lebensraumes ins Gedächtnis, es lässt einen auch all seine Ziele klarer sehen; keine deiner Gewohnheiten kann dich hier runterziehen. Das Positive tritt von selbst hervor. Während wir die fast sechshundert Meter über wacklige Pfade auf den erloschenen Vulkan Mount Keelung steigen, weht es uns aus dem Tal Erkenntnisse und – kuriose Mischung – Beethovens „Für Elise“, die Erkennungsmelodie der Müllwagen, empor. Ach ja. „Für Elise“ – in Taipei leider nicht gespielt, weil dort fast jeden Tag alle Arten von Müll abgeholt werden und daher keine Notwendigkeit zur Differenzierung der Müllmelodien besteht – ist so etwas wie die inoffizielle Nationalhymne der Insel. Selbst wenn man in schwindelerregender Höhe auf Mt. Keelung über dem Meer steht, schwebt dennoch diese klassische Musik zu einem empor. Wir müssen beim Abstieg über den absurden Gedanken lachen, dass wahrscheinlich kaum ein Volk der Welt in einem so hohen Prozentsatz den Anfang von „Für Elise“ kennt – aber nicht das Ende. Dieses Land ist so seltsam, es könnte schon fast wieder Deutschland sein. Wenigstens ich kenne auch keinen anderen Ort auf der Erde, der standardmäßig Glas in seine Gehwegplatten einbrennt – weil sie dann so schön glitzern. Ein bisschen Magie ist im taiwanesischen Alltag immer dabei, in welcher Aufmachung sie einem auch erscheinen mag.
Wenn es dunkel geworden ist und der Bus uns über die Serpentinenstraßen wieder von Jiufen fortträgt, erleuchten die Tempel, Friedhofshügel und die ehemalige Bergarbeiterstadt in zartem Goldschimmer – und auf einmal sieht die Stadt aus, als sei sie immer noch pulsierendes Zentrum einer längst erloschenen Industrie und mitnichten irgendeine Touristenattraktion.